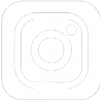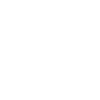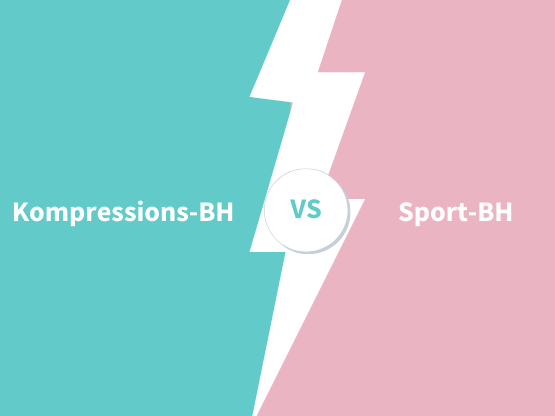„Nach der Diagnose ging alles so schnell“
Brustkrebs mit Anfang 30 – die Diagnose traf Christine Raab völlig unvorbereitet. Was da mit ihr geschah, realisierte sie erst, als ein Großteil der Therapien bereits hinter ihr lag.

Im November 2014 erhielt Christine Raab die Diagnose Brustkrebs – sie war damals gerade einmal 32 Jahre alt, arbeitete in Großostheim, einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt am Main, als Make-up Artist und gab regelmäßig Schwimmkurse für Kinder. Fragt man sie heute, wie sie den Tumor entdeckte, muss Raab lachen: Denn der Knoten in ihrer linken Brust fiel nicht ihr auf, sondern ihrem Mann Timo. Tatsächlich war die Verhärtung schon damals gut fühlbar. Bis heute wundert sich Raab, wie sie den Knoten übersehen konnte.
Ernsthafte Sorgen machte die junge Frau sich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht: „Ich dachte, das wäre eine Zyste“, sagt sie. So etwas hatte ihre Oma auch mal gehabt – und Zysten lassen sich schließlich einfach rausoperieren.
Die Frauenärztin war ebenfalls nicht beunruhigt. „In Ihrem Alter wird da nichts Schlimmes sein“, sagte sie. Dann tastete sie Raabs Brüste ab und ihr Lächeln verschwand – plötzlich fühlte Raab sich unwohl. „Das sollten wir abklären lassen“, erklärte die Frauenärztin. Wenig später stand Raab wieder auf der Straße, in der Hand die Überweisung zum Radiologen für die Mammografie.
Mit dem Überweisungsschein in der Hand setzte Raab sich ins Auto. Dann griff sie nach ihrem Handy und rief ihren Freund an. Er nahm nicht ab, also wählte Raab die Nummer ihrer Mutter. „Ich musste einfach mit irgendwem reden“, erinnert sie sich. Denn auch, wenn ihre Gynäkologin meinte, dass sie sich erst mal keine Sorgen machen müsse, merkte sie, wie sie es mit der Angst zu tun bekam. Als sich die Mutter meldete und Raab ihr von dem Knoten erzählte, reagierte diese mindestens genauso geschockt wie ihre Tochter. Doch allein eine vertraute Stimme zu hören, half Raab, sich wieder zu beruhigen. „Da wird schon nichts sein“, sagte sie sich, „ich bin schließlich erst 32.“ Dann startete sie den Motor und fuhr los.
Nach der Mammografie folgte die Stanzbiopsie
Zwei Tage später fuhr Raab ins Röntgenzentrum nach Aschaffenburg – es war ein Freitag. Dort sollte die Mammografie stattfinden. Die Untersuchung dauerte nicht lang, der Moment, in dem ihre Brüste zwischen die zwei Röntgenplatten „gequetscht“ wurden, war jedoch „schmerzhaft und unangenehm“. Das Ergebnis des Ultraschalls schickten die Ärzte dann zurück an ihre Frauenärztin. „Sie wird Sie anrufen“, wurde Raab von einem der Radiologen informiert.
Der Tag verging, kein Anruf. Dann kam das Wochenende und auch am Montag blieb der Anruf aus. Am Dienstag wollte Raab nicht länger warten und griff selbst zum Hörer. Die Arzthelferin erklärte ihr, dass sie schon versucht hätten, sie zu erreichen – nur hatten sie offenbar noch eine alte Nummer – und stellte sie zur Ärztin durch.
Die Frauenärztin erklärte Raab, dass die Mammografie die vermutete Gewebeveränderung bestätigt habe. Um zu klären, ob diese gut- oder bösartig sei, bräuchte es nun eine sogenannte Stanzbiopsie, eine Untersuchung, bei der ihr mit einer sehr dünnen Nadel ein Stück des verdächtigen Gewebes entnommen würde.
Die Stanzbiopsie fand drei Tage später im Brustzentrum des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau statt. Raab war aufgeregt. Gar nicht so sehr, weil sie sich vor dem Ergebnis fürchtete – tatsächlich war nach wie vor für sie klar, dass „da schon nichts sein wird“ – , sondern weil sie Angst vor der Nadel hatte. „Die Biopsie war dann auch wirklich verdammt schmerzhaft“, erinnert sie sich.
Was eigentlich nicht hätte sein müssen. Denn vor der Gewebeentnahme wird die Brust lokal betäubt. Das Problem: Bei Raab hatte der Anästhesist offenbar eine Stelle vergessen oder die Betäubung hatte bereits wieder nachgelassen. Beim Einstechen der Nadel spürte sie nicht nur, wie sich die gut 1,5 Millimeter dicke Hohlnadel durch ihre Haut bohrte, sondern auch, wie sie ein Stück Brustgewebe herausriss. Zurück zu Hause hatte Raab Schmerzen wie nie zuvor – „da halfen nur noch Schmerztabletten.“
Wenige Tage später fuhr sie ein zweites Mal nach Aschaffenburg, dieses Mal zusammen mit ihrem Ehemann. „Die Ärztin, die mir die Diagnose mitteilte, war supernett“, erinnert sich Raab. Die Worte „hormonabhängiger Tumor“ waren dennoch ein Schock. Denn obwohl der Knoten in ihrer Brust nicht zu leugnen war, war der Satz „Da wird schon nichts sein“ inzwischen zu ihrem festen Mantra geworden. Und auch nachdem die Diagnose Brustkrebs feststand, blieb der Tumor für Raab abstrakt. Sie fühlte sich schließlich fit, gab weiterhin regelmäßig ihre Schwimmkurse und hatte abgesehen von diesem Knubbel keinerlei körperliche Beschwerden – und selbst der Knubbel tat nicht weh.
Das Einfrieren von Eizellen als Sicherheitsmaßnahme
Dann fiel das Wort Chemotherapie. „Plötzlich sah ich all die Bilder von Menschen mit kahlen Köpfen vor mir“, erinnert sich Raab. In diesem Moment begann sie das erste Mal zu ahnen, was auf sie zukommen würde und was die Diagnose Krebs für sie persönlich bedeutete. Die junge Frau begann zu zittern. Dann spürte sie, wie ihr Mann Timo ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter legte, atmete tief durch und richtete sich wieder auf.
„Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen“, beruhigte sie auch die Ärztin: „Sie sind noch so jung, das kriegen Sie hin.“ Aufgrund ihres Alters empfahl sie Raab außerdem, sich einige Eizellen entnehmen und diese einfrieren zu lassen. Zwar könne man im Vorhinein nicht wissen, ob die Krebsbehandlung ihre Fruchtbarkeit tatsächlich beeinträchtigen würde, aber sicher sei sicher.
Bislang hatte Raab noch gar nicht ans Kinderkriegen gedacht, dennoch stimmte sie zu. Denn: „Sicher ist sicher“ hallte es in ihr nach. Die 5000 Euro, die das Einfrieren zusammen mit der Hormonbehandlung kosten würde, musste Raab selbst zahlen. Wieder zu Hause suchte sie im Internet nach der nächstgelegenen Kinderwunschklinik und vereinbarte einen Termin.
Im Brustzentrum folgten parallel weitere Untersuchungen: Um sicherzugehen, dass der Tumor nicht gestreut hat, schickten die Ärzte Raab ins MRT, checkten ihre Organe, nahmen Blut ab. Doch Raab kam mittlerweile nicht mehr hinterher: Seit Wochen hetzte sie von einer Untersuchung zur nächsten, von einem Arztgespräch zum anderen. Gleichzeitig versuchte sie, ihre Schwimm- und Make-up-Kurse nicht ein weiteres Mal ausfallen zu lassen, lag in der Nacht wach und konnte immer noch nicht glauben, dass das jetzt wirklich gerade mit ihr geschah: dass sie mit 32 Jahren tatsächlich Krebs hatte.
Die Entscheidung der Ärzte und deren Therapieempfehlungen hat die heute 36-Jährige in dieser Zeit kaum hinterfragt. „Während der Behandlung habe ich tatsächlich viele Frauen getroffen, die besser informiert waren als ihre Ärzte“, erinnert sich Raab. Sie wollte das bewusst nicht – auch, um sich nicht zusätzlich verunsichern zu lassen. Stattdessen nahm sie sich vor, sich voll und ganz auf die Behandlung zu konzentrieren. Das, was sie machte, wollte sie mit „vollem Herzen“ tun.
Im Januar 2015 begann die Chemotherapie, sechs Sitzungen im Abstand von jeweils drei Wochen. Die Behandlung wurde nicht in einem Krankenhaus durchgeführt, sondern ambulant in einer auf gynäkologischen Krebs spezialisierten Frauenarztpraxis. Die Atmosphäre fand Raab gemütlich, nahezu familiär, denn statt sich mit bis zu 40 Patientinnen einen Behandlungsraum zu teilen, saß sie hier nur mit fünf, maximal sechs weiteren Personen zusammen. Dazu gab es während jeder Sitzung Kaffee und Kekse.
Vor den Begleiterscheinungen der Chemotherapie konnte die familiäre Atmosphäre sie jedoch nicht bewahren: Raab war übel, sie hatte Verstopfungen, war hungrig, hatte aber keinen Appetit. Die Schleimhäute ihres Gaumens, die sich durch die Chemotherapeutika entzündet hatten, versuchte sie mit Gurgellösungen zu behandeln. Kam sie nach vier Stunden Chemotherapie nach Hause, war sie müde und abgeschlagen. An diesen Tagen schaffte sie es gerade noch, sich aufs Sofa zu legen, den Fernseher einzuschalten und sich berieseln zu lassen. „Mehr war einfach nicht drin“, erinnert sie sich.
Nach zwei Wochen fielen der 32-Jährigen die Haare aus. Für diesen Fall hatte sie sich im Vorhinein eine Perücke besorgt sowie einige Tücher. Die Wimpern und Augenbrauen, die sich lösten, schminkte sie nach und wünschte sich: „Lass es schnell vorbeigehen.“ Doch der Wunsch ging nicht in Erfüllung: Nach der letzten Chemo-Sitzung entwickelte sie zusätzlich ein sekundäres Lymphödem (mehr hierzu im Interview).
Dem Körper Zeit geben, sich zu regenerieren
Nach Abschluss der Chemotherapie wurde schließlich im Mai 2015, ein oder zwei Wochen vor ihrem 33. Geburtstag, der Tumor in einer brusterhaltenden Operation entfernt. An ihrem Geburtstag rief ihr Arzt Raab an und verkündete ihr, dass bei der Operation keine Krebszellen übersehen worden waren, eine Nachoperation sei also nicht notwendig. Der Tumor hatte nicht gestreut und sie sei ab jetzt „krebsfrei“. „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte er mir nicht machen können“, sagt Raab.
Das Wissen, nun endlich „krebsfrei“ zu sein, gab ihr auch neue Kraft für die folgende Bestrahlung. Außerdem wollte sie mit ihrem Mann in den Urlaub fahren. Auch das gab ihr die Energie, die Strahlentherapie – insgesamt 36 Sitzungen – möglichst schnell durchzuziehen. Damit der „Strahlenkater“, also das Gefühl schlapp und kraftlos zu sein, ihr nicht den ganzen Tag versaute, legte Raab sich die Termine diszipliniert auf 10 Uhr morgens.
Heute, drei Jahre später, hat Raab mit der Brustkrebserkrankung weitestgehend abgeschlossen. Auch die Nebenwirkungen der Hormontherapie haben nachgelassen. Statt Schwimmkurse für Kinder gibt sie heute Meditations- und Yogakurse. Und weil sie während der Krebsbehandlung mitbekommen hat, wie viele Hormone in Cremes und Make-up stecken, hat sie sich in ihrem Beruf als Kosmetikerin nun auf Naturkosmetik spezialisiert. „Langsam habe ich meinen Alltag wieder“, sagt Raab.
Nach wie vor schwierig findet sie, dass ihre operierte Brust um einiges kleiner ist als die gesunde. Schon vor der brusterhaltenden Therapie war sie etwa einen Cup kleiner; jetzt, nach der Brust-OP, beträgt der Unterschied jedoch beinahe zwei Cup-Größen. Raab hat sich im Sanitätsgeschäft deshalb eine Ausgleichsschale besorgt. Sie persönlich findet die Asymmetrie zwar nicht schlimm – auch ihren Freund stört das Größenverhältnis nicht. Aber Raab zeigt gerne Dekolleté – „und die Oberteile sitzen einfach besser, wenn die Brüste gleich groß sind“, findet sie.
Fragen wie „Was wäre gewesen, wenn ...?“, stellt Raab sich nicht. Stattdessen versucht sie, sich immer wieder bewusst zu machen, dass ihr Körper durch die Brustkrebserkrankung viel durchgemacht hat und dass er Zeit braucht, um sich zu regenerieren – ebenso wie sie selbst.
10. Dezember 2018
Foto: Timo Raab